Systeme spielen
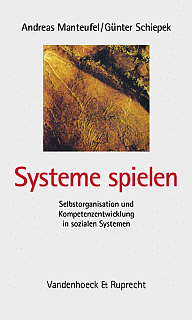
Systeme spielen
Selbstorganisation und Kompetenzentwicklung in sozialen Systemen
Manteufel & Schiepek, unter Mitarbeit von: Reicherts, Rott, Strunk &
Wewers (1998)
Vandenhoeck & Ruprecht
Der Beitrag von Strunk (Complexity-Research) bezieht sich auf den
Anhang
B und die Programmierung der Auswertungssoftware "Matrix".
Weitere Bücher
Klappentext
Der Titel Systeme spielen ist eine sprachliche Kippfigur: Sie bedeutet einerseits, daß in diesem Buch anhand praktischer Fälle beschrieben wird, wie die Spiele der Kommunikation beschaffen sind, mit denen sich komplexe soziale Systeme selbst ihre Struktur und Ordnung schaffen. Die Autoren gehen der Frage nach, wie Selbstorganisation in sozialen Systemen funktioniert und mit welchen Theorien und Methoden Prozesse der Strukturbildung und des Strukturwandels angemessen zu beschreiben sind. Mit anderen Worten: Was passiert, wenn Organisationen lernen?
Die zweite Bedeutung des Titels spricht ein neues Spiel an: In Systemspielen, einer Variante des bekannten Planspielansatzes, lässt sich die Dynamik sozialer Systeme inszenieren, miterleben, teilnehmend beobachten - und empirisch beforschen. Es wird über die Erfahrungen in und mit der Durchführung von Systemspielen sowie das damit verbundene Forschungsprogramm einer sozialwissenschaftlichen Synergetik berichtet (einschließlich empirischer Ergebnisse und Methoden). Zentral wird schließlich die Frage behandelt, wie Selbsterfahrung und der Erwerb von praxisrelevanten Handlungskompetenzen in komplexen Systemen beim System-Spielen möglich sind. Mit anderen Worten: Wie erwirbt man Systemkompetenz?
Visualisierung der Interaktionsdynamik in sozialen Systemen
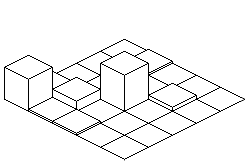
Mitte der 1990er Jahre wurde von Guido Strunk (Complexity-Research) ein Computerprogramm zur Analyse von Interaktionsmatrizen im Zeitverlauf entwickelt. Dieses bildet die Grundlage für die in der Abbildung dargestellte Interaktionsdynamik und wurde in dem Buch "Systeme Spielen" als Auswertungsmethodik für soziale Systeme vorgestellt. Die Zeilen sind die Sender einer Kommunikation und die Spalten die Empfänger. Die Höhe der Balken gibt die Zahl der Interaktionen pro Zeittakt wieder. Im Zeitverlauf verändern sich die Interaktionsmuster.